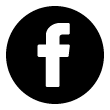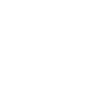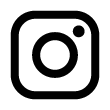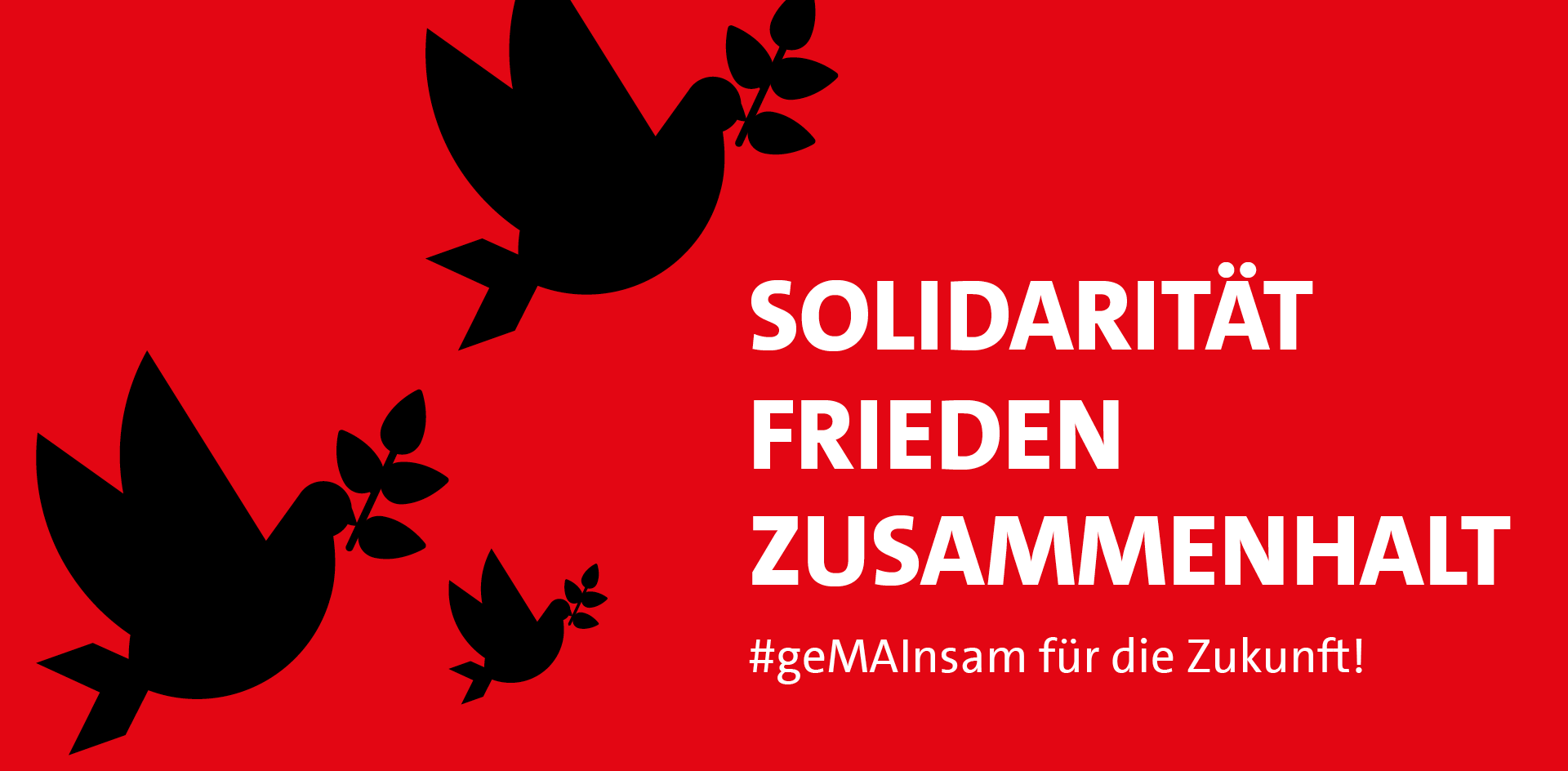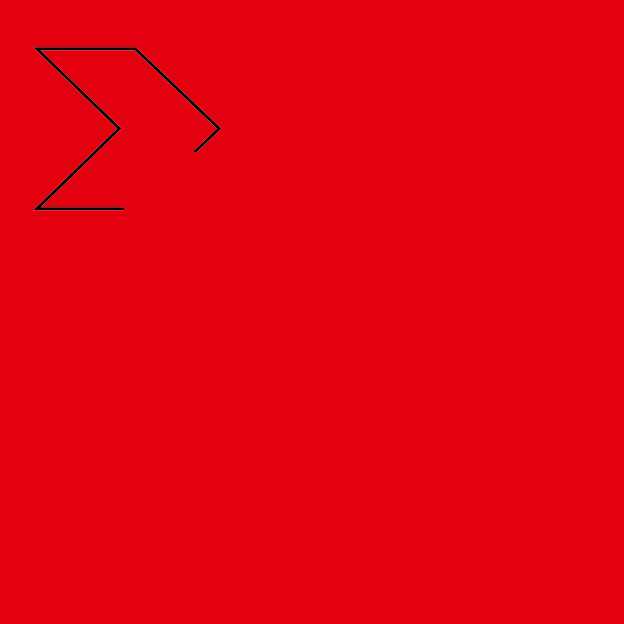Schön, dass Sie da sind!
Liebe Panketalerinnen und Panketaler,
wir begrüßen Sie herzlich auf der Internetseite der SPD Panketal. Hier können Sie sich über unsere Aktivitäten informieren und mit uns in Kontakt treten. Nutzen Sie die Möglichkeit, uns Ihre Anliegen, Ihre Sorgen oder Anregungen mitzuteilen.
Wir wollen Panketal bewegen – mit Vielfalt und Kompetenz.
Machen Sie mit !!!
Fühlen Sie sich zu unseren Versammlungen herzlich eingeladen! Auch dort haben Sie Gelegenheit Fragen zu stellen und Ihre Anliegen vorzutragen. Sollten Sie Interesse an einer Teilnahme haben, freut sich unsere Fraktion über eine kurze Nachricht an fraktion@panketal-spd.de . Sie bekommen dann weitere Informationen zur Teilnahme. An welchen Tagen und Orten sich unser Ortsverein und unsere Fraktion der Gemeindevertretung trifft, finden Sie im Bereich „Termine“.
Mit freundlichen Grüßen
Alexandra Csoma & Taito Radtke
Ihre Ortsvereinsvorsitzenden
Willi Brandt
AKTUELLES
TERMINE/PRESSE/NEWS
Klarstellung: SPD Panketal hat sich nicht der Stellungnahme des OV Wandlitz angeschlossen
Entgegen der Berichterstattung in der MOZ hat sich die SPD Panketal nicht an der Stellungnahme des SPD-Ortsvereins Wandlitz zum „Artikelgesetz zum Bürokratieabbau“ beteiligt. Weder gab es einen Beschluss des Ortsvereinsvorstands noch eine offizielle Positionierung zu der Petition „Demokratieabbau stoppen – Zivilgesellschaftliche Rechte in Brandenburg verteidigen!“. Ein einzelnes Mitglied der SPD Panketal hat die Petition privat unterstützt – dies erfolgte jedoch ausdrücklich nicht im Namen des Ortsvereins.
Die SPD Panketal möchte zur Berichterstattung vom 22. Juli 2025 festhalten, dass der Eindruck einer gemeinsamen Ablehnung des „Artikelgesetzes zum Bürokratieabbau“ durch die Ortsvereine Wandlitz und Panketal nicht den Tatsachen entspricht.
Weder gab es einen Beschluss des Ortsvereinsvorstands noch eine offizielle Positionierung des Ortsvereins SPD Panketal zu der Petition „Demokratieabbau stoppen – Zivilgesellschaftliche Rechte in Brandenburg verteidigen!“. Auch die im Artikel zitierte Stellungnahme ist ausschließlich eine Positionierung des OV Wandlitz.
Der Vorstand der SPD Panketal hat sich im Vorfeld mit dem Gesetzespaket auseinandergesetzt und dazu die Landtagsabgeordneten der SPD in Gespräche einbezogen. Auf dieser Grundlage wurde entschieden, die Petition nicht zu unterstützen.
Richtig ist lediglich, dass ein einzelnes Mitglied der SPD Panketal die Petition privat unterzeichnet hat. Dieses individuelle Engagement erfolgte ausdrücklich nicht im Namen des Ortsvereins.
Wir bitten die Redaktion um eine Richtigstellung, um Missverständnisse in der öffentlichen Wahrnehmung zu vermeiden.
SPD Panketal
Die Ortsvereinsvoritzenden
Alexandra Csoma & Taito Radtke
SPD Barnim nominiert Daniel Kurth mit rund 96 Prozent als ihren SPD-Landratskandidaten.

Barnim / Eberswalde – Die SPD Barnim hat am Samstag, dem 01. März, im Bürgerbildungszentrum Amadeu Antonio in Eberswalde Daniel Kurth offiziell als ihren SPD-Kandidaten für die kommende Landratswahl im Frühjahr 2026 nominiert. In der Mitgliederversammlung im Bürgerbildungszentrum Amadeu Antonio in Eberswalde erhielt Kurth als einziger Bewerber sehr breite Zustimmung. Von 46 stimmberechtigten anwesenden Mitgliedern stimmten 44 mit Ja, es gab eine Enthaltung und eine Gegenstimme.
Kurth, der das Amt bereits seit sieben Jahren innehat, betonte in seiner Bewerbungsrede zentrale Herausforderungen für den Landkreis in den kommenden Jahren. Themen wie Bevölkerungswachstum, Schulsanierungen, Infrastrukturprojekte am Finowkanal sowie Gesundheit und Soziales standen im Fokus. Dabei ging er auch auf den Umgang mit Rechtspopulisten und die Auswirkungen internationaler Entwicklungen auf unsere Heimat ein.
„Mit Daniel Kurth haben wir als SPD Barnim einen starken und überzeugenden Kandidaten für die Landratswahlen im Frühjahr 2026 aufgestellt. Mit klarem Kurs und stabilen Wertegerüst führt Daniel bereits seit sieben Jahren unseren Landkreis als Landrat und kämpft für eine gute Entwicklung vor Ort in schweren Zeiten. Jetzt wo wir sehen, wie Mehrheiten mit der AfD von Seiten der CDU nicht mehr nur zufällig zustande kommen und offensiv zivilgesellschaftliche Projekte angegriffen werden, ist dies wichtiger denn je. Als SPD Barnim sind wir damit jetzt auf dem Platz und machen ein konkretes Angebot. Wir freuen uns auf anstehende Gespräche und inhaltliche Diskussionen für einen gemeinsamen, demokratischen Kurs für unseren Landkreis. Wer diesen gemeinsam mit uns gehen möchte, ist herzlich eingeladen“, so Kurt Fischer, SPD-Landtagsabgeordneter und Vorsitzender der SPD Barnim.
Die Krankenhausversorgung bleibt ein zentrales Thema für den Landkreis Barnim. Als Aufsichtsratsvorsitzender der GLG betonte Kurth die Notwendigkeit von Diskussionen und Gesprächsbereitschaft über zukünftige Strukturen. Es brauche eine große Kraftanstrengung für eine zukunftsfähige und bestmögliche Gesundheitsversorgung in der Region. Die aktuelle Debatte um die Klinikstandorte in der Uckermark zeigt die Bedeutung regionaler Zusammenarbeit.
Daniel Kurth begründete den frühen Wahlkampfauftakt mit der Notwendigkeit, die Bürgerinnen und Bürger frühzeitig auf die anstehende Wahl aufmerksam zu machen und für die Bedeutung der Kreispolitik zu werben. Die geringe Wahlbeteiligung bei der letzten Landratswahl zeigt, dass es entscheidend sei, das Bewusstsein für die wichtigen Funktionen eines Landrates zu stärken. Jetzt sei die Zeit, um ins Gespräch zu kommen, breite Bündnisse zu schmieden und einen gemeinsamen Zukunftskurs für unseren Landkreis zu entwickeln.
Wann die anderen Parteien ihre Kandidaten benennen, ist derzeit noch offen.
SPD-Ortsverein Panketal organisiert Gedenken zum Holocaustgedenktag

Auch dieses Jahr haben die demokratischen Parteien und Wählervereinigungen sowie ihre Fraktionen der Gemeindevertretung Panketal aufgerufen, zum Jahrestag der Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau und der beiden anderen Konzentrationslager Auschwitz durch die Rote Armee am 27. Januar 1945 am Mahnstein „Die Würde des Menschen ist unantastbar“ auf dem Dorfanger in Zepernick aller Opfer des Nationalsozialismus zu gedenken. Dem Aufruf sind zahlreiche Bürgerinnen und Bürger gefolgt. Unter ihnen der Bürgermeister Panketals. Herr Max Wonke (SPD), die Ortsvorsteher von Schwanebeck, Herr Lutz Grieben (Die Linke) und Zepernick, Herr Andreé Reschke (CDU), der Vorsitzende der Gemeindevertretung Panketal, Herr Uwe Voß (SPD) sowie weitere Mitglieder der Gemeindevertretung.
Bevor zum Gedenken an die Opfer Blumengebinde am Fuß des Mahnsteins niedergelegt wurden, trugen Herr Walter Seeger (Geschichtsverein Panketal „Heimathaus e.V.“) und Pastor Wolf Fröling (Evangelische Kirchengemeinde Zepernick-Schönow) zwei eindrucksvolle Gedenkreden vor, die wir mit freundlicher Genehmigung im Anschluss ungekürzt dokumentieren.
Walter Seeger:
Meine sehr verehrten Damen und Herren,
Die Befreiung von Auschwitz am 27. Januar 1945 markiert einen der bedeutendsten Momente in der Geschichte der Menschheit.
Es ist ein Tag, an dem wir uns an die unvorstellbaren Gräueltaten erinnern, die während des Holocausts begangen wurden, und an die unermessliche Tapferkeit und das Opfer derjenigen, die überlebt haben.
Heute, 80 Jahre später, stehen wir hier, um die Opfer zu ehren und sicherzustellen, dass solche Verbrechen niemals wieder geschehen.
Auschwitz, ein Name, der für immer mit Schrecken und Leid verbunden ist, war das größte und berüchtigtste der nationalsozialistischen Konzentrations- und Vernichtungslager. Mehr als eine Million Menschen, die überwiegende Mehrheit von ihnen Juden, wurden hier ermordet.
Männer, Frauen und Kinder wurden systematisch ihrer Menschlichkeit beraubt, gefoltert und getötet. Die Befreiung dieses Lagers durch die Rote Armee brachte das volle Ausmaß der nationalsozialistischen Verbrechen ans Licht und schockierte die Welt.
Wir erinnern uns an die sechs Millionen Juden, die ermordet wurden, sowie an die Millionen anderer, die ebenfalls verfolgt und getötet wurden: Roma, Sinti, politische Gefangene, Homosexuelle, Menschen mit Behinderungen und viele andere.
Außerdem gedenken wir der Völker, die nach der nationalsozialistischen Ideologie keine Daseinsberechtigung haben sollten und der Vernichtung preisgegeben wurden, Polen, Russen und andere osteuropäische Völker und Volksgruppen.
Ihr Leid und ihr Tod dürfen niemals vergessen werden.
Wir denken auch an die Überlebenden, die trotz unvorstellbarer Qualen und Verluste den Mut gefunden haben, weiterzuleben und ihre Geschichten zu erzählen.
Ihre Zeugnisse sind von unschätzbarem Wert, denn sie erinnern uns daran, was geschehen ist, und mahnen uns, wachsam zu bleiben.
Sie sind die lebenden Beweise für die Grausamkeit, zu der Menschen fähig sind, aber auch für die Stärke und den Überlebenswillen des menschlichen Geistes.
Die Befreiung von Auschwitz war nicht nur das Ende eines der dunkelsten Kapitel der deutschen Geschichte, sondern auch der Beginn eines neuen Zeitalters der Erinnerung und der Verantwortung.
Es ist unsere Pflicht, die Erinnerung an die Opfer lebendig zu halten und sicherzustellen, dass zukünftige Generationen aus der Vergangenheit lernen können. Wir müssen uns gegen Antisemitismus, Rassismus und jede Form von Hass und Intoleranz stellen. Wir sollen verpflichtet sein uns für eine Welt einzusetzen, in der die Würde und die Rechte jedes Einzelnen respektiert werden.
In den letzten 80 Jahren haben wir manches erreicht. Die Vereinten Nationen wurden gegründet, um den Weltfrieden zu fördern und die Menschenrechte zu schützen. Internationale Abkommen wie die Genfer Konventionen wurden verabschiedet, um Kriegsverbrechen zu verhindern und die Rechte von Kriegsgefangenen und Zivilisten zu schützen.
In vielen Ländern wurden Gesetze erlassen, um Diskriminierung zu bekämpfen und die Gleichberechtigung zu fördern.
Doch trotz dieser Fortschritte gibt es immer noch viel zu tun. Antisemitismus und Rassismus sind nach wie vor weit verbreitet, und in vielen Teilen der Welt werden Menschen aufgrund ihrer Herkunft, ihres Glaubens oder ihrer Überzeugungen verfolgt und diskriminiert.
Es ist unsere gemeinsame Verantwortung, gegen diese Ungerechtigkeiten vorzugehen und eine Welt zu schaffen, in der alle Menschen in Frieden und Würde leben können.
Die Erinnerung an Auschwitz und den Holocaust ist nicht nur eine historische Pflicht, sondern auch eine moralische Verpflichtung.
W i r müssen sicherstellen, dass die Lehren aus der Vergangenheit nicht vergessen werden und dass wir alles in unserer Macht Stehende tun, um eine Wiederholung solcher Verbrechen zu verhindern.
Dies erfordert zugegebenermaßen Mut, Entschlossenheit und die Bereitschaft, für das Richtige einzustehen, auch wenn es schwierig ist.
Heute, am 80. Jahrestag der Befreiung von Auschwitz, erneuern wir unser Versprechen, die Erinnerung an die Opfer zu bewahren und für eine gerechtere und friedlichere Welt zu kämpfen.
Wir gedenken der Toten, ehren die Überlebenden und verpflichten uns, ihre Geschichten weiterzuerzählen. Wir geloben, wachsam zu bleiben und uns gegen Hass und Intoleranz zu stellen, wo immer sie auftreten.
Es muss auch an die jüdischen Bewohner erinnert werden, die vor 1933 in Zepernick lebten. Nach meinen Forschungen konnte ich 65 Personen ermitteln, die verfolgt wurden, weil sie nach der nationalsozialistischen Ideologie als Juden, Halbjuden, Vierteljuden oder jüdisch versippt bezeichnet wurden.
Davon wurden nachweislich 30 Personen in den Konzentrations- und Vernichtungslagern ermordet, während 20 Personen nachweislich überlebten. Mehrheitlich waren die Überlebenden Ehepartner von nicht-jüdischen Zepernickern, die sich geweigert hatten, sich scheiden zu lassen.
Das Schicksal von 15 Personen konnte ich nicht ermitteln; sie haben keine Spuren hinterlassen.
Für einige der Ermordeten wurden in Zepernick Stolpersteine verlegt. Ich nenne nun deren Namen:
Wolfgang Benning, Goslarer Straße,
Moritz Löwenthal, Gerda Löwenthal, Poststraße,
Salomon Seelig, Hedwig Seelig, Emil Hans Seelig, Walter Seelig, alle Hufelandstraße,
Jenny Gold, Straußstraße,
Selma Kübler, Heinestraße.
Lasst uns die Erinnerung an die Opfer von Auschwitz und des Holocaust in unseren Herzen tragen und ihre Geschichten weitergeben.
Es ist auch wichtig, die Rolle der Befreier zu würdigen, die ihr Leben riskierten, um die Gefangenen von Auschwitz zu befreien.
Die Soldaten der Roten Armee, die das Lager erreichten, waren Zeugen des unvorstellbaren Leids und der Zerstörung, das dort stattfand.
Ihre Tapferkeit und ihr Mitgefühl verdienen unseren tiefsten Respekt und unsere Dankbarkeit.
Die Befreiung von Auschwitz war der Beginn eines langen Weges der Heilung und der Suche nach Gerechtigkeit.
Die Nürnberger Prozesse, die nach dem Krieg stattfanden, waren ein wichtiger Schritt, um die Verantwortlichen für die Verbrechen des Holocausts zur Rechenschaft zu ziehen.
Diese Prozesse setzten einen Präzedenzfall für die internationale Strafgerichtsbarkeit und zeigten, dass Verbrechen gegen die Menschlichkeit nicht ungestraft bleiben dürfen.
In den Jahrzehnten seit der Befreiung von Auschwitz haben Überlebende, Historiker und Aktivisten unermüdlich daran gearbeitet, die Erinnerung an den Holocaust lebendig zu halten. Gedenkstätten, Museen und Bildungsprogramme auf der ganzen Welt tragen dazu bei, das Bewusstsein für die Schrecken des Holocausts zu schärfen.
Wir müssen uns weiterhin für eine Welt einsetzen, in der alle Menschen in Frieden und Würde leben können, und gegen jede Form von Hass und Intoleranz kämpfen.
Heute, am 80. Jahrestag der Befreiung von Auschwitz, stehen wir zusammen, um der Opfer zu gedenken und unser Versprechen zu erneuern, für Gerechtigkeit, Frieden und Menschlichkeit zu kämpfen.
Die Erinnerung an Auschwitz und den Holocaust ist eine Mahnung, dass wir niemals aufhören dürfen, für das Richtige einzustehen und die Würde jedes Einzelnen zu schützen.
Pfarrer Wolf Fröling:
Liebe Anwesende,
die Rote Armee traf am 27. Januar 1945, heute vor 80 Jahren, in Auschwitz ein. Sie fand nur noch einige Tausend Häftlinge, die nicht auf die Todesmärsche gehen konnten, sie sollten eigentlich erschossen werden, aber der Vormarsch der Roten Armee ging zu schnell.
1100000 Menschen wurden in Auschwitz von der SS ermordet in dreieinhalb Jahren.
Die letzten Vergasungen fanden statt im November 1944 – 32 jüdische Häftlinge des so genannten „Sonderkommandos“, zur Beseitigung der Leichen aus den Gaskammern gezwungen, wurden als Mitwisser hingerichtet.
Die vier Gaskammern wurden anschließend gesprengt und viele schriftliche Unterlagen vernichtet.
Auschwitz zeigt, wozu Menschen fähig sind.
Der BBC-Regisseur Laurence Rees, Autor einer sechsteiligen Filmdokumentation über Auschwitz von vor 20 Jahren, erzählt, er habe keine ehemaligen Nazis getroffen, die ihm sagten: Ich hatte nun einmal den Befehl, diese Menschen umzubringen, sondern er spricht im Interview von „Verinnerlichung des Glaubens“, weil alle sagten: „Zu der Zeit, als das passiert ist, dachte ich, dass es richtig war, was ich tat“.
Der Historiker Saul Friedländer führte in der Geschichtswissenschaft den Begriff des „Erlösungs- Antisemitismus“ ein, um den Nationalsozialismus zu beschreiben im Sinne von: Wenn es uns gelingt, alle Juden dieser Welt zu liquidieren, dann wird die Menschheit gerettet. In einem frühen Kampflied der SA wird gesungen: „Wenn vom Messer spritzt das Judenblut, dann geht es uns nochmal so gut.“
Der Kommandant von Auschwitz, Rudolf Höß, schrieb in polnischer Haft vor seiner Hinrichtung in seinen Memoiren über den organisatorischen Leiter des Holocaust: „Adolf Eichmann war total besessen von seiner Tätigkeit, alle erreichbaren Juden zu vernichten. Er sagte: „Wenn es uns jetzt nicht gelingt, die biologischen Grundlagen des Judentums zu zerstören, so werden die Juden dereinst das deutsche Volk vernichten.“ Rassischer Verfolgungswahn in seiner schlimmsten Ausprägung.
Unsere jüdischen Schwestern und Brüder, wir Christen haben mit ihnen den ersten Teil der Bibel, das Alte Testament gemeinsam, was im Judentum „Thenach“ heißt.
Wir sind streng genommen eine jüdische Sekte historisch gesehen.
Unsere jüdischen Schwestern und Brüder, sie haben den Satz geprägt: „Das Geheimnis von Erlösung heißt Erinnerung.“ Wir sind heute hier zusammen gekommen, um uns zu erinnern, was heute vor 80 Jahren geschehen ist. Nicht, weil wir Nachgeborenen Schuld tragen, sondern weil wir als Nachgeborene eine Verantwortung dafür besitzen, dass ein solches Menschheitsverbrechen wie Auschwitz eben nie wieder geschieht.
Und so gehört christlicherseits zur Erinnerung eben dazu, dass wir uns kritisch mit unserer eigenen Kirchengeschichte auseinandersetzen.
Zu unserer lokalen Kirchengeschichte hier vor Ort in Zepernick gehört zum Beispiel dazu, dass 1927 der spätere Reichsführer SS Heinrich Himmler hier in der Kirche geheiratet hat. Auch wenn der damalige Zepernicker Ortsgeistliche Herzberg sich weigerte, diese Trauung vorzunehmen und ein mit Himmler befreundeter evangelischer Pfarrer von auswärts diesen Gottesdienst zu Eheschließung vorgenommen hat die Eltern von Frau Himmler hatten in der Ahornallee ein Grundstück besessen, und traditionell heiratete man dort, wo die Braut wohnte, Himmler war aus München und außerdem nicht evangelischen Bekenntnisses. Er hatte später, als er an der Macht war, seine SS-Männer dazu angehalten, aus der Kirche auszutreten.
Was lässt sich sagen zur Rolle der evangelischen Kirche im Dritten Reich?
Sie hatte, so lässt es sich aus heutiger Sicht sagen, offensichtlich der jahrzehntelangen Verbindung zwischen Thron und Altar aus dem Kaiserreich hinterher getrauert und fremdelte mit der Weimarer Republik, betrachtete diese in vielen Veröffentlichungen als „gottlos gewordenen Staat“.
Als der greise Reichspräsident Paul von Hindenburg am 30. Januar 1933 die Macht in die Hände von Adolf Hitler gab, dem Führer der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei (NSDAP), da gab es viele in der Kirche, die es begrüßten, dass nun nach den Jahren von Chaos und politischer Unordnung nun wieder ein starker Staat angebrochen war.
Dass der Antisemitismus in ihm Staatsdoktrin von Anbeginn sein sollte, das störte die wenigsten. Der Generalsuperintendent der Kurmark Otto Dibelius, er predigte im Gottesdienst am „Tag von Potsdam“, dem 21. März 1933 in der Potsdamer Nikolaikirche am Alten Markt, er würdigte die „Zurückdrängung des jüdischen Einflusses“, die nun angebrochen war.
Menschen wie Dietrich Bonhoeffer, der klar sagte: „Nur, wer für die Juden schreit, darf auch gregorianisch singen“, verkörperten in der evangelischen Kirche nur eine Randgruppe.
Lediglich die von den Nazis propagierte Gleichschaltung der evangelischen Landeskirchen zu einer deutschen „Reichskirche“ und die damit einhergehende Einmischung des totalitären Staates in innerkirchliche Angelegenheiten führte zur Gründung der „Bekennenden Kirche“ in Abgrenzung zur „Glaubensbewegung Deutsche Christen“, nicht etwa die Distanz zum nationalsozialistischen Staat.
Das Recht, ein anderer zu werden, unabhängig von der eigenen Herkunft, die im christlichen Glauben keine Rolle spielt, wird im Neuen Testament an vielen Stellen betont. Im Nationalsozialismus hingegen war die Herkunft eines Menschen entscheidend für das persönliche Fortkommen – jeder musste einen so genannten „arischen Nachweis“ beibringen, der belegen konnte, keine jüdischen Vorfahren zu besitzen.
Und die ganzen Judenverfolgungen, sie gingen die Kirche nichts an, so glaubte man, handelte es sich doch um Angehörige einer anderen Religion, und offiziell hieß es ja pseudowissenschaftlich ohnehin, dass Jüdinnen und Juden einer „anderen Rasse“ angehörten, also von ihrer Blutzusammensetzung andere Menschen seien, Untermenschen sozusagen.
Schon allein die ganze Einteilung von Menschen in arische, also wertvolle Menschengruppen und weniger wertvolle in der Ideologie des Nationalsozialismus, hätte von der Bibel her nichts anderes verdient als scharfen Widerspruch.
Die Bibel fordert uns auf, keinerlei Raum zu geben der Finsternis. Einer Finsternis, wie sie sich in Entstehung und Durchführung von Auschwitz besonders gezeigt hat.
Wenn wir der Opfer des Nationalsozialismus gedenken 80 Jahre nach der Befreiung von Auschwitz durch die Rote Armee, dann machen wir als Kirche auch deutlich, dass wir uns verabschiedet haben von aller Gleichgültigkeit gegenüber dem Ungeist des Nationalsozialismus, der von einer verschiedenen Wertigkeit von Menschen ausgeht und wir brechen als Kirche mit unserer eigenen fatalen Tradition eines Antijudaismus, der in unseren jüdischen Schwestern und Brüdern eine überlebte, rückständige Religion am Werke sieht. Viel zu lange hat sich die Kirche gedrückt um eine selbstkritische Auseinandersetzung mit ihrer eigenen Geschichte, hat lange Zeit zum Beispiel nicht die schlimme Judenfeindschaft des Reformators Martin Luther zum Thema gemacht, hat schlichtweg die Kapitel 911 im Römerbrief ignoriert, wo der Apostel Paulus sehr klar schreibt: „Nicht Du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt Dich.“
80 Jahre nach 1945 machen wir uns große Sorgen um das politische Klima bei uns hier in Deutschland vier Wochen vor der vorgezogenen Bundestagswahl und auch nach der Einführung des 47. US-Präsidenten Donald Trump, der schon einmal als 45. US-Präsident vier Jahre lang amtieren durfte, von 2017 bis 2021.
Der Kulturmanager Axel Hegmann schrieb am Freitag auf seiner Facebook-Seite: „Ein 22-jähriger durchgeknallter Afghane in Aschaffenburg schafft, was ein saudiarabischer AfD-Sympathisant in Magdeburg nicht erreichte: Merz hat die Brandmauer eingerissen. Und dann sieht er noch jeden Tag Trump Dekrete rauswuchten. Ab sofort müssen wir alles tun,
um unsere freiheitliche Grundordnung zu retten!“
In diesem Sinne habe ich mich Anfang letzter Woche gefreut über die deutlichen Worte der anglikanischen Bischöfin Mariann Edgar Budde in Washington nach der Einführung von Trump. Und die Reaktionen der Trump-Leute sprechen Bände. Ein republikanischer Abgeordneter schlug vor, den Namen der Bischöfin auf eine Deportationsliste mit aufzunehmen.
Trump selbst forderte eine Entschuldigung für ihre Worte der Predigt. Ich hingegen fand die Klarheit der Bischöfin ergreifend, wie sie für den Schutz all derer eingetreten ist, denen eine erneute Präsidentschaft von Trump jetzt Angst macht, weil auf ihrem Rücken in den USA Wahlkampf gemacht wurde.
Die stellvertretende Kirchenpräsidentin von Hessen-Nassau, Ulrike Scherf, hatte sich hinter die Bischöfin in den USA gestellt und geschrieben: „Das ist genau die Rolle, die wir als Kirche einnehmen müssen, wenn marginalisierte Gruppen ausgegrenzt werden sollen: Wir stehen in biblischer Tradition für Solidarität mit den Schwachen. Vor Gott sind wir Menschen alle gleich, und entsprechend sollten wir uns gegenseitig behandeln.“ Dazu gehört eben auch, dass wir uns hier vor Ort engagieren und gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit entgegentreten.
Und eben das Wort aus dem Judentum beherzigen:
„Das Geheimnis von Erlösung heißt Erinnerung.“
Ungeschönte Erinnerung, damit wir aus der Vergangenheit unsere Lehren ziehen können und unserer Verantwortung gerecht werden.
Vielen Dank!
SPD-Ortsverein Panketal wählt erstmals Doppelspitze und verabschiedet Niels Templin als Vorsitzenden

Am 13. Dezember 2024 fand die Mitgliederversammlung des SPD-Ortsvereins Panketal statt. Neben einem Rückblick auf die politische Arbeit des vergangenen Jahres stand die Neuwahl des Vorstands im Mittelpunkt.
Nach starkem Engagement wurde der bisherige Vorsitzende Niels Templin feierlich verabschiedet. Er wird sich künftig voll auf seine Aufgaben als Fraktionsvorsitzender, Gemeindevertreter sowie um die Kunstbrücke und Hilfen für die Ukraine in Panketal konzentrieren. „Ich danke dem gesamten Vorstand und unseren Mitgliedern für die großartige Unterstützung im letzten Jahr“, betonte der scheidende Vorsitzende in seiner Abschiedsrede.
Ein historischer Moment folgte bei den Neuwahlen: Zum ersten Mal in der Geschichte des SPD-Ortsvereins wurde eine Doppelspitze gewählt. Die neuen Vorsitzenden, Alexandra Csoma und Taito Radtke, freuen sich auf die gemeinsame Verantwortung und sehen den Ortsverein für die kommenden Herausforderungen gut aufgestellt. „Mit vereinten Kräften gehen wir motiviert ins neue Jahr und den bevorstehenden Bundestagswahlkampf“ , kündigte die frisch gewählte Doppelspitze an. Für den Austausch mit den Panketalerinnen und Panketalern werden mehr gemeinsame Veranstaltungen geplant. So werde die SPD regelmäßige für alle offene Stammtischtreffen organisieren und vorher auf der Webseite des Ortsvereins und im Panketal-Boten bekannt gegeben.
Unterstützt werden Csoma und Radtke von Max Wonke (Bürgermeister der Gemeinde Panketal), Niels Templin (SPD Fraktionsvorsitzender Panketal), Hubert Michel, Joachim Pieczkowski und Dr. Johannes Klein-Heßling, die einstimmig als Beisitzer des Vorstandes gewählt wurden. Ebenfalls einstimmig bestätigt wurde Dr. Thomas Schmidt als Kassierer des Ortsvereins.
Im Anschluss an die Versammlung lud der SPD-Ortsverein zur Weihnachtsfeier ein. Rund 30 Mitglieder und Gäste kamen in geselliger Runde zusammen, um das ereignisreiche Jahr 2024 gemeinsam ausklingen zu lassen. Bei festlicher Stimmung, gutem Essen, Julklapp und anregenden Gesprächen wurde der Teamgeist weiter gestärkt.
Der SPD-Ortsverein Panketal blickt optimistisch in die Zukunft und bedankt sich bei allen Mitgliedern und Unterstützern für das Vertrauen und die Zusammenarbeit im vergangenen Jahr. Im neuen Jahr laden die SPD-Ortsvereine Panketal und Bernau gemeinsam mit den für den Wahlkreis direkt gewählten Abgeordneten Simona Koß (Deutscher Bundestag) und Martina Maxi Schmidt (Landtag Brandenburg) zum Neujahrsempfang am 31. Januar 2025 im Stadtmauertreff Bernau ein. Um vorherige Anmeldung wird per E-Mail gebeten.